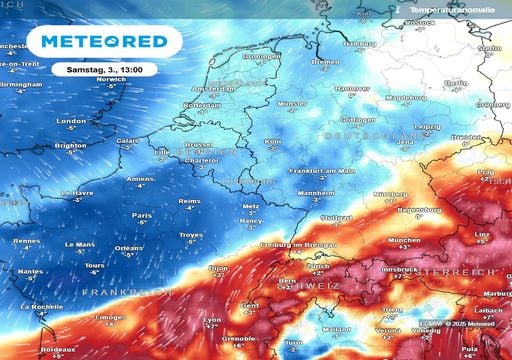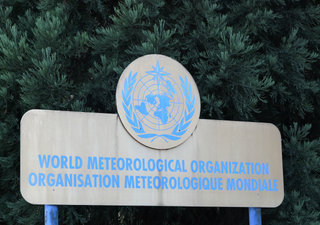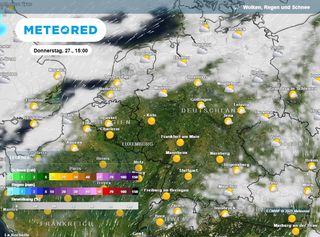Deutsche Hobbygärtner aufgepasst: Bundesregierung fordert Torf-Verzicht im Garten bis 2026!
Die Bundesregierung hat ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2026 soll der Torfeinsatz im Freizeitgartenbau nahezu vollständig vermieden werden. Dies ist Teil eines umfassenden Klimaschutzplans, der darauf abzielt, die CO₂-Emissionen zu verringern und die wertvollen Moorböden zu schützen. Hobbygärtner sind gefragt, auf umweltfreundlichere Alternativen umzusteigen.

Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung hat Maßnahmen festgelegt, um den Torfeinsatz im Gartenbau zu verringern und den CO₂-Ausstoß zu reduzieren.
Torf, der in Moorböden über Jahrtausende Kohlenstoff speichert, setzt beim Abbau CO₂ frei, was zur Verstärkung der Klimakrise beiträgt.
Die Bundesregierung strebt daher an, den Torfeinsatz zu minimieren und Alternativen zu entwickeln.
Moore als Kohlenstoffsenken und Auswirkungen des Torfabbaus
Moore bedecken nur etwa 3 % der Landfläche, speichern jedoch 21-33 % des organischen Kohlenstoffs. Der Torfabbau und dessen Nutzung setzen diesen Kohlenstoff als CO₂ frei, was zu erheblichen Emissionen führt.
Diese werden in der Treibhausgasberichterstattung erfasst und dem jeweiligen Land angerechnet. Die Zersetzung von Torf nach dem Abbau erfolgt schneller als bei anderen Moornutzungen und hat bis zum Ende des Jahrhunderts deutlich negativere Klimawirkungen, selbst wenn die Flächen später wieder vernässt werden.
Ziele und Maßnahmen des Klimaschutzplans 2050
Im Freizeitgartenbau soll bis 2026 ein nahezu vollständiger Verzicht auf Torf erreicht werden. Auch im Erwerbsgartenbau soll der Torfanteil bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich gesenkt werden.
Zudem werden Vorgaben in den Vergaberichtlinien für öffentliche Aufträge im Garten- und Landschaftsbau umgesetzt, die Torfersatzstoffe bevorzugen. Um diese Ziele zu erreichen, setzt die Bundesregierung auf Informationskampagnen und Fachberatung.
Aktuelle Torfabbauzahlen in Deutschland
Laut dem Industrieverband Garten e.V. (IVG) werden in Deutschland jährlich auf weniger als 8.000 Hektar Torf abgebaut, wobei der Großteil aus Niedersachsen stammt.
Im Jahr 2005 wurden noch etwa 8 Millionen Kubikmeter Torf abgebaut, während diese Zahl bis 2019 auf 4,7 Millionen Kubikmeter gesenkt wurde. Der Abbau von Torf ist rückläufig, doch der Bedarf an Torf bleibt hoch.
2023 wurden insgesamt 7,9 Millionen Kubikmeter Substrate in Deutschland abgesetzt. Davon entfallen etwa 1,8 Millionen Kubikmeter auf Kultursubstrate für den Erwerbsgartenbau und 4 Millionen Kubikmeter auf Blumenerden für Hobbygärtner.
Der Anteil an Torfersatzstoffen steigt stetig. Für Kultursubstrate im Erwerbsgartenbau betrug der Anteil an Torfersatzstoffen 27 Prozent, bei Blumenerden für Hobbygärtner lag dieser Anteil bei bis zu 41 Prozent.
Alternative Ausgangsstoffe für Substrate
Die Substratherstellung setzt zunehmend auf alternative Ausgangsstoffe wie Grünkompost (1,53 Millionen Kubikmeter jährlich), Holzfasern und Holz (887.000 Kubikmeter jährlich), Rindenhumus (270.000 Kubikmeter jährlich), Kokosprodukte (130.000 Kubikmeter jährlich) und mineralische Stoffe wie Perlite und Ton (191.000 Kubikmeter jährlich).
Diese Alternativen ermöglichen es, den Torfeinsatz zu reduzieren und gleichzeitig die Anforderungen an Substrate zu erfüllen.

Forschung und Entwicklung von Torfersatzstoffen
Die Forschung zu Torfersatzstoffen hat in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht.
In der Hobbygärtnerei können Torfersatzstoffe bereits vollständig oder größtenteils den Torf ersetzen.
Im professionellen Gartenbau stellt der Ersatz von Torf jedoch größere Herausforderungen dar, da eine Umstellung auf torfreduzierte Substrate oft mit höheren Produktionskosten und Anpassungen der Prozesse verbunden ist.
Erste Praxisberichte zeigen jedoch, dass eine Umstellung auf ein Substrat mit bis zu 50 Prozent Torfersatzstoffen ohne hohe Kostensteigerungen möglich ist.
Quelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Torfverwendung reduzieren – Klima schützen.